Literatur und CDs
Entdecken Sie die Vielfalt unserer plattdeutschen Literatur und CDs. In diesem Bereich bieten wir Ihnen eine Übersicht über unseren Bestand.
Alle diese Artikel stehen Ihnen zur Bestellung in unserem Shop zur Verfügung.
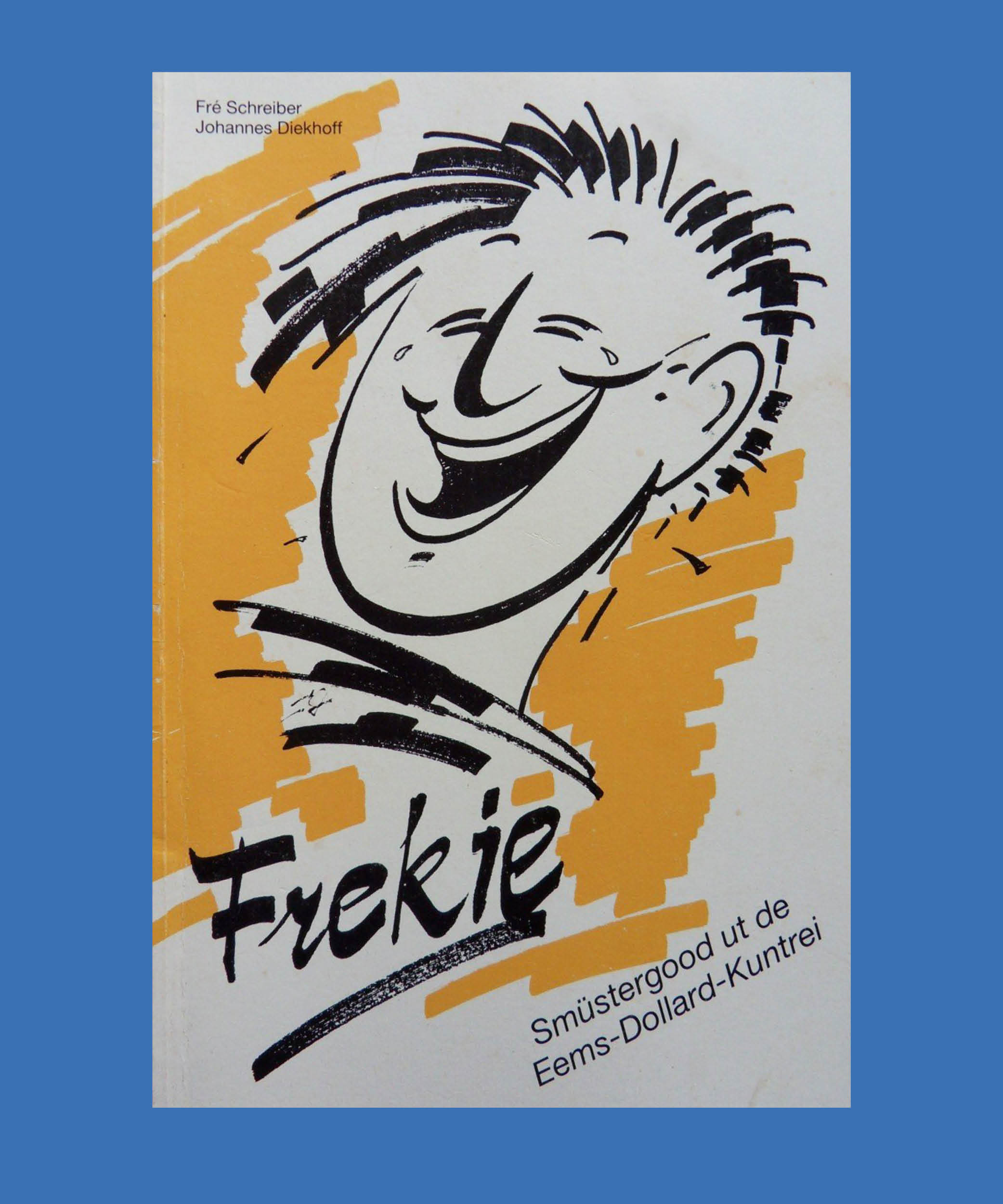
Frekie
Frè Schreiber / Johannes Diekhoff
Kleine Geschichten zum Schmunzeln aus dem Ems-Dollart-Gebiet. 48 Seiten
5,- Euro
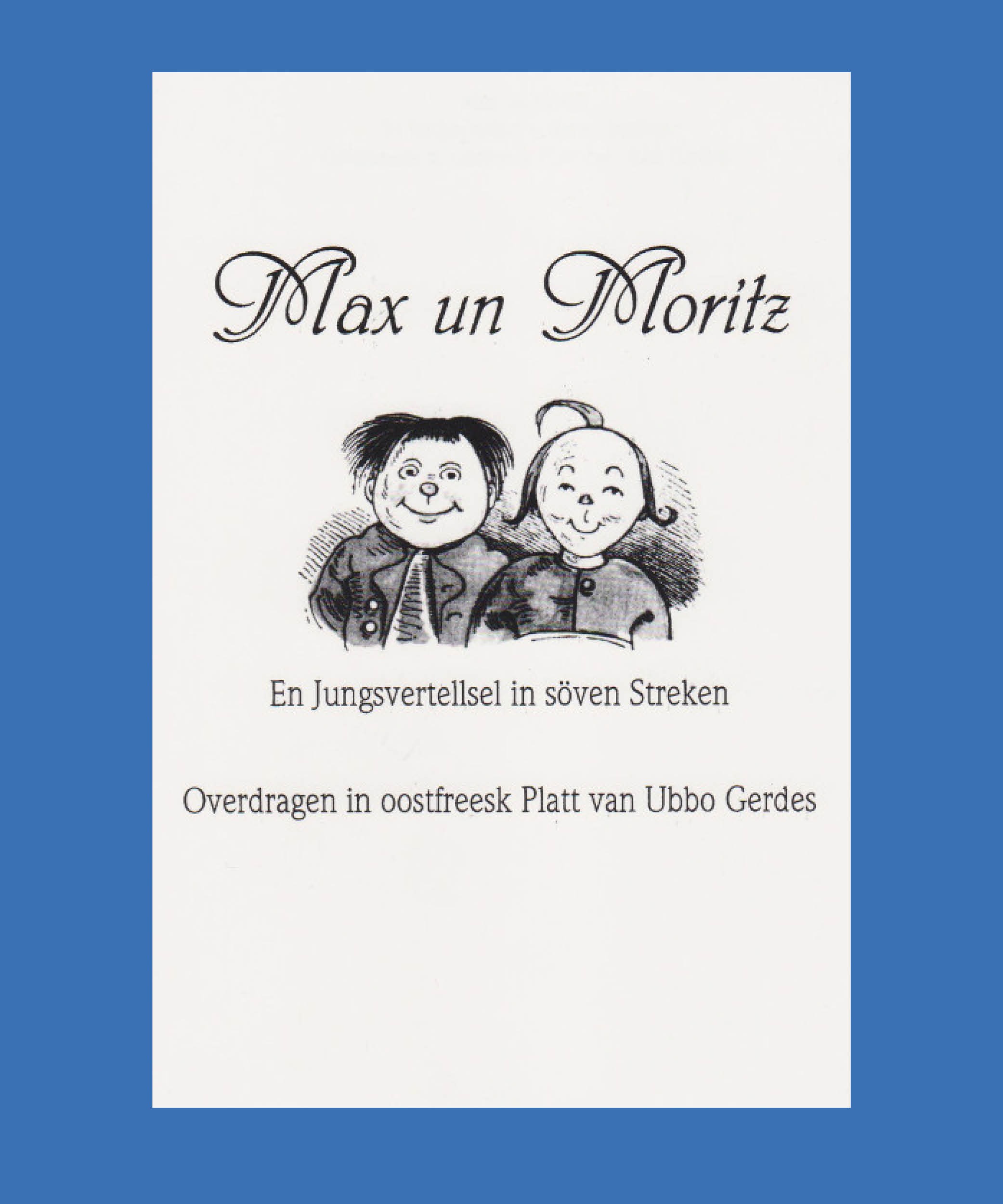
Max un Moritz
Wilhelm Busch / Plattdeutsch von Ubbo Gerdes
Wilhelm Busch auf Platt - da werden die Streiche von Max und Moritz noch viel lustiger. 30 Seiten
6,50 Euro / 5,- Euro für Mitglieder
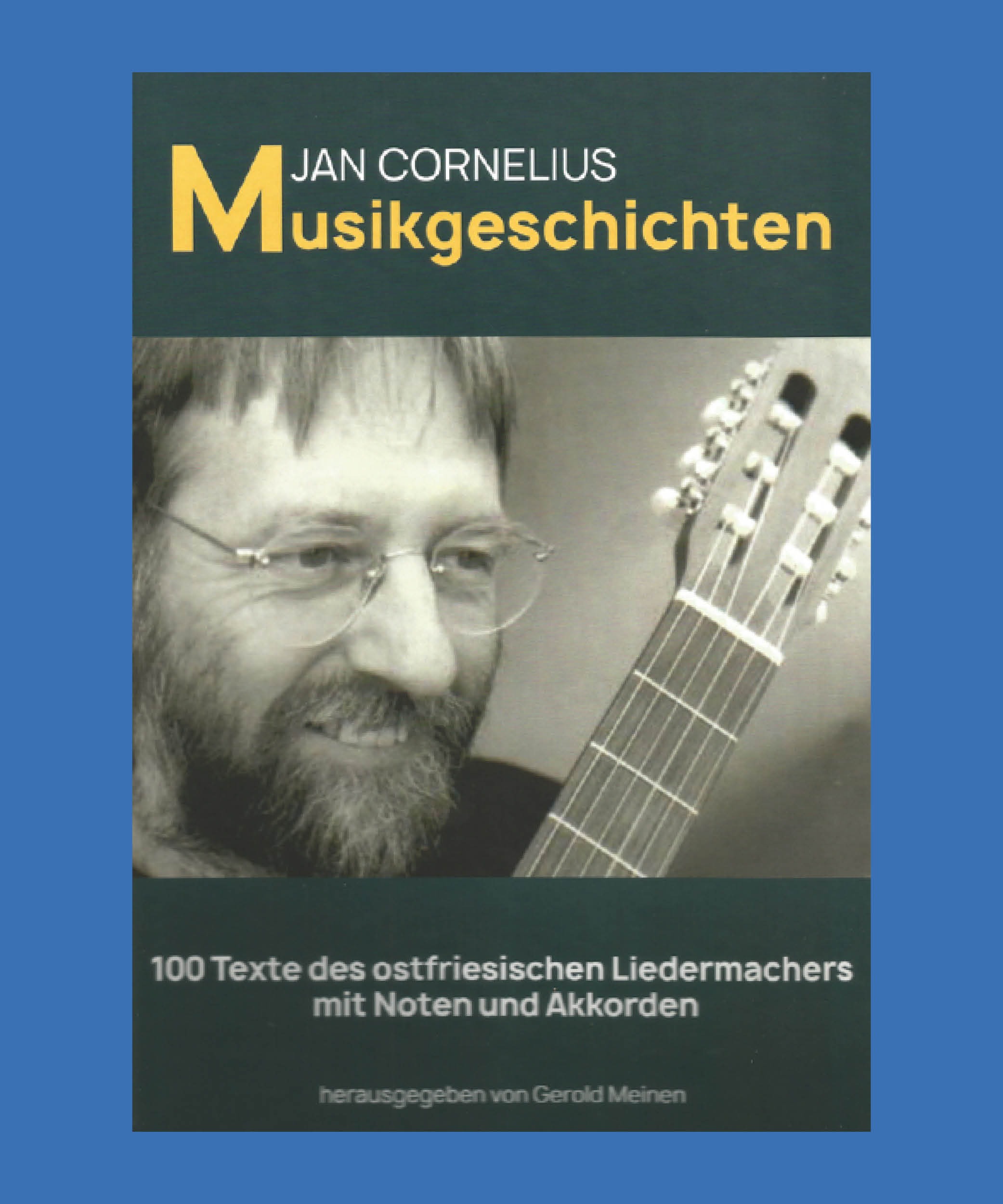
Musikgeschichten
100 Texte des ostfriesischen Liedermachers Jan Cornelius mit Noten und Akkorden.
Herausgegeben von Gerold Meinen
20,- Euro
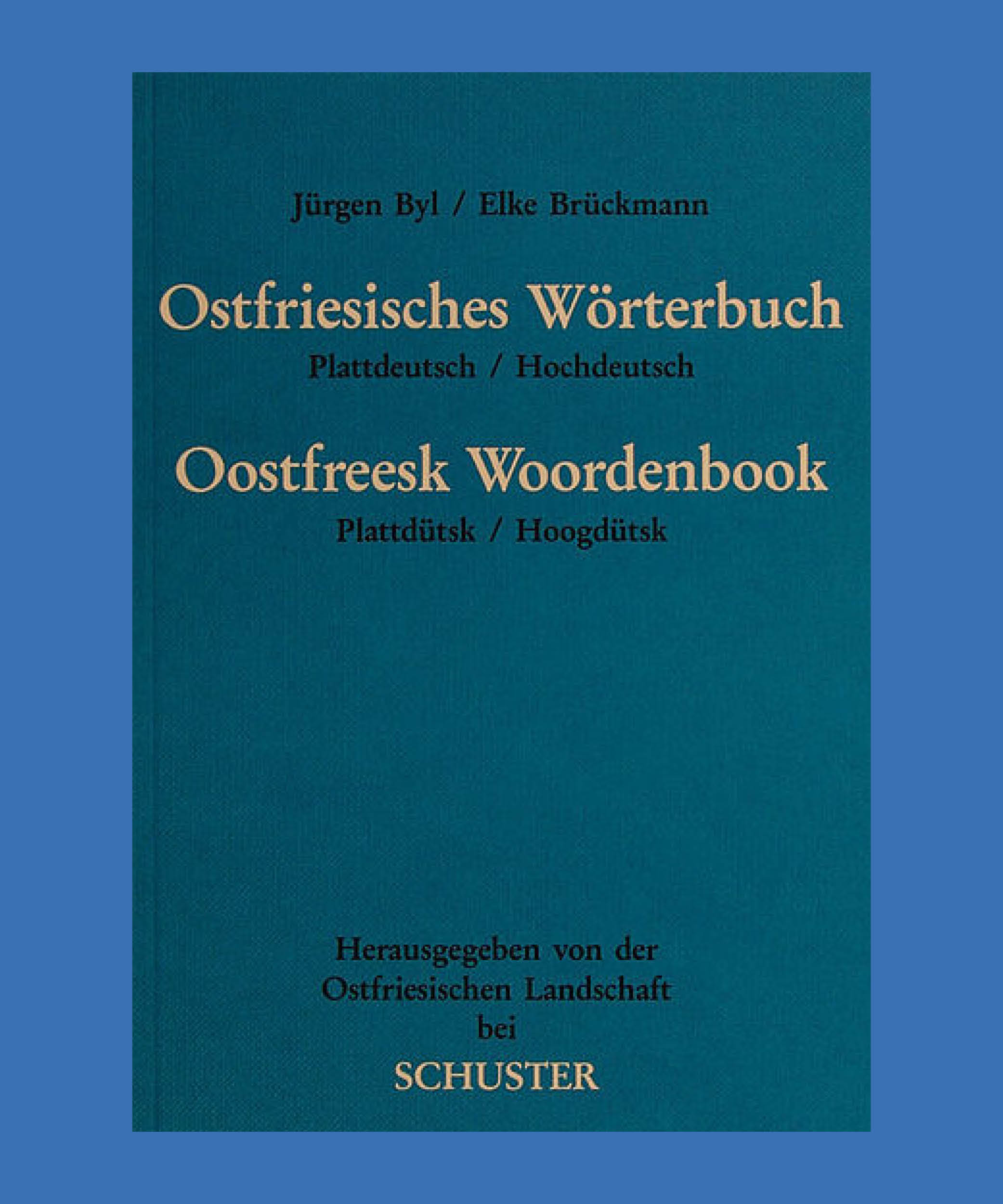
Ostfriesisches Wörterbuch I
Oostfreesk Woordenbook
Jürgen Byl und Elke Brückmann
Plattdeutsch-Hochdeutsches Wörterbuch. 168 Seiten
12,50 Euro / 10,- Euro für Mitglieder
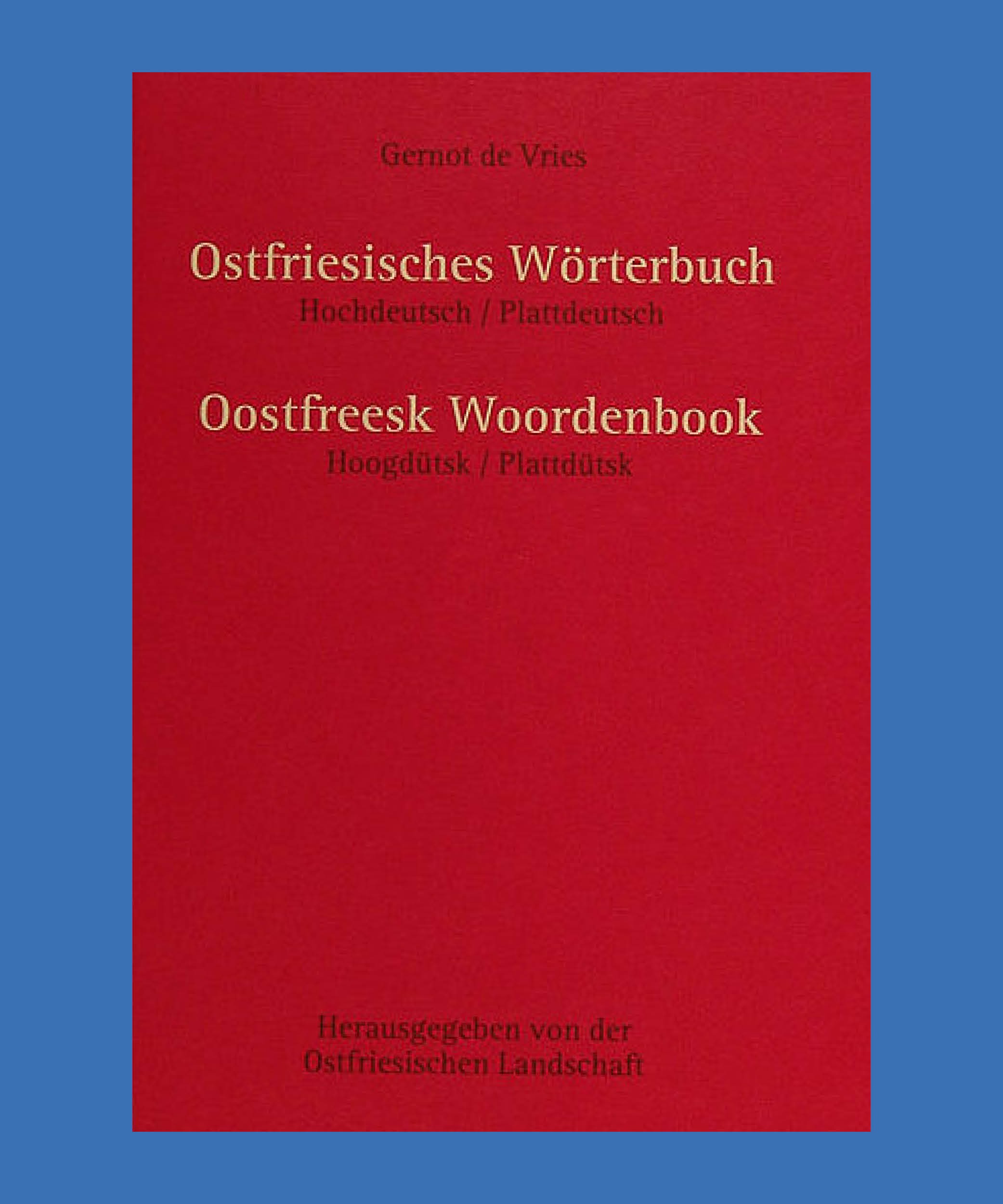
Ostfriesisches Wörterbuch II
Oostfreesk Woordenbook
Gernot de Vries
Hochdeutsch-Plattdeutsches Wörterbuch.
15.000 Stichwörter. 445 Seiten
25,- Euro / 12,50 Euro für Mitglieder
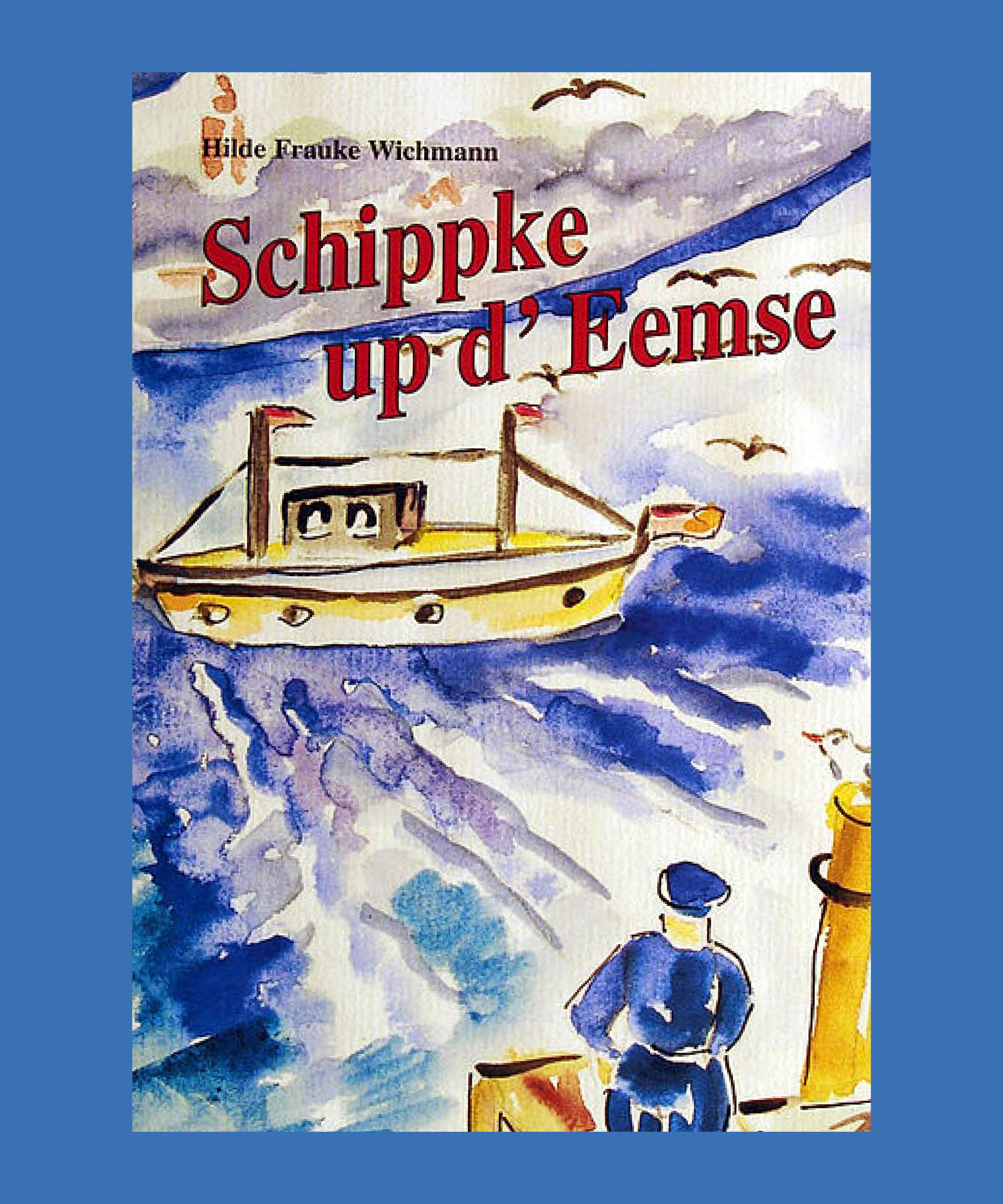
Schippke up d´ Eemse
Hilde Frauke Wichmann
Drei Geschichten von der Ems und dem Mond, von einem Fährschiff und einer Traumreise mit dem Großen Wagen. 54 Seiten
10,- Euro / 8,50 Euro für Mitglieder
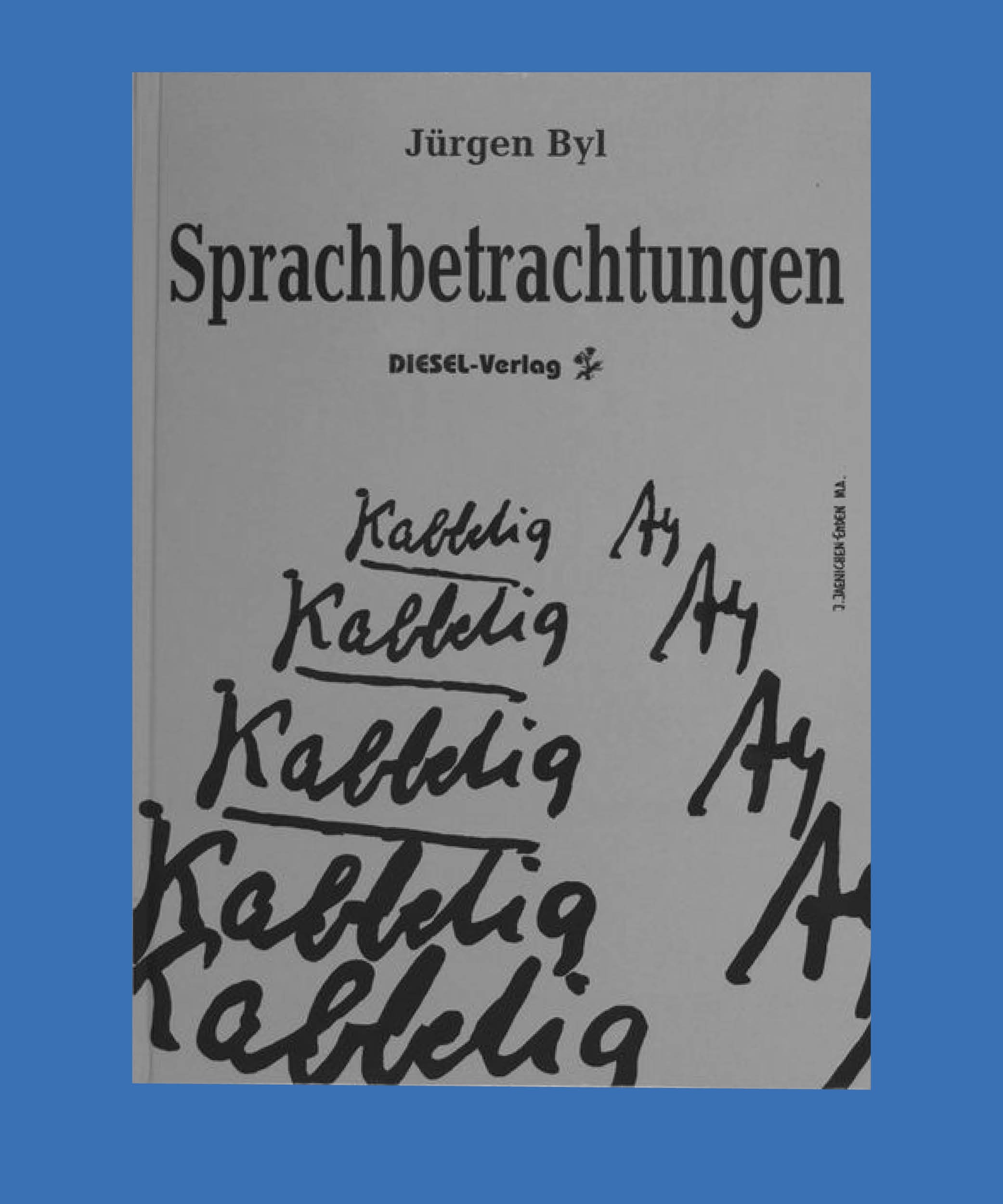
Sprachbetrachtungen
Jürgen Byl
Über Herkunft und Bedeutung von 99 Wörtern und Sprichwörtern aus unserem Zweisprachenland. Von „Platt as en Pannkook“ über „Kloot un Boßel“ und „Quaad“ bis zu „Speckendicken“. 114 Seiten
10,- Euro / 5 ,- Euro für Mitglieder
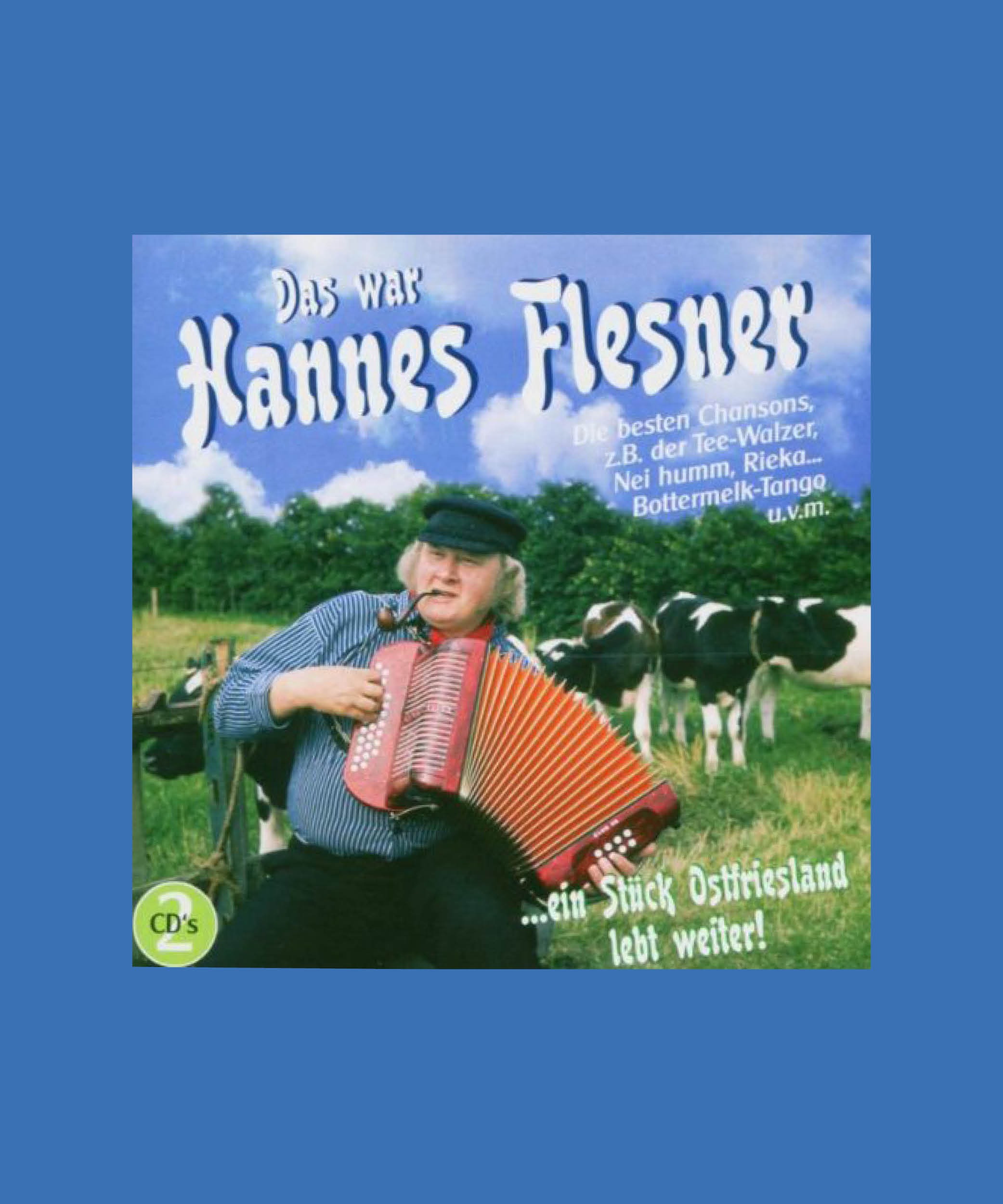
Das war Hannes Flesner
Hannes Flesner
2 CD's
Die besten Chansons, z. B. Tee-Walzer, Nei humm, Rieka ..., Bottermelk-Tango u. v. m.
20,- Euro / 17,- Euro für Mitglieder
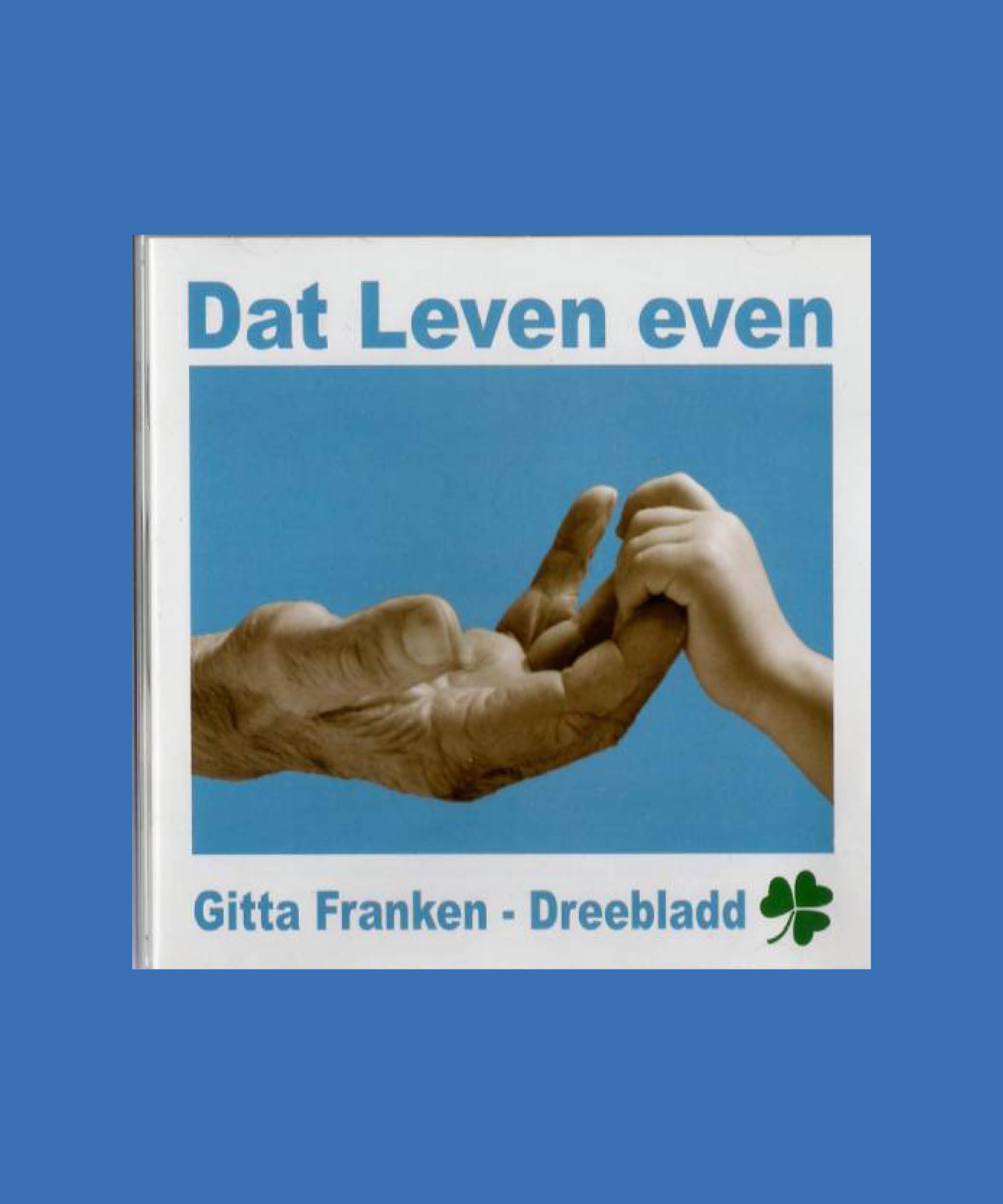
Dat Leven even
Gitta Franken - Dreebladd
CD
16 Lieder in ostfriesischer Sprache von Gitta & Udo Franken und Ute de Haan. z. B. Ik bün en lüttjen Vögel, Froo Müller, Tied för mi ...
14,95 Euro / 13,- Euro für Mitglieder
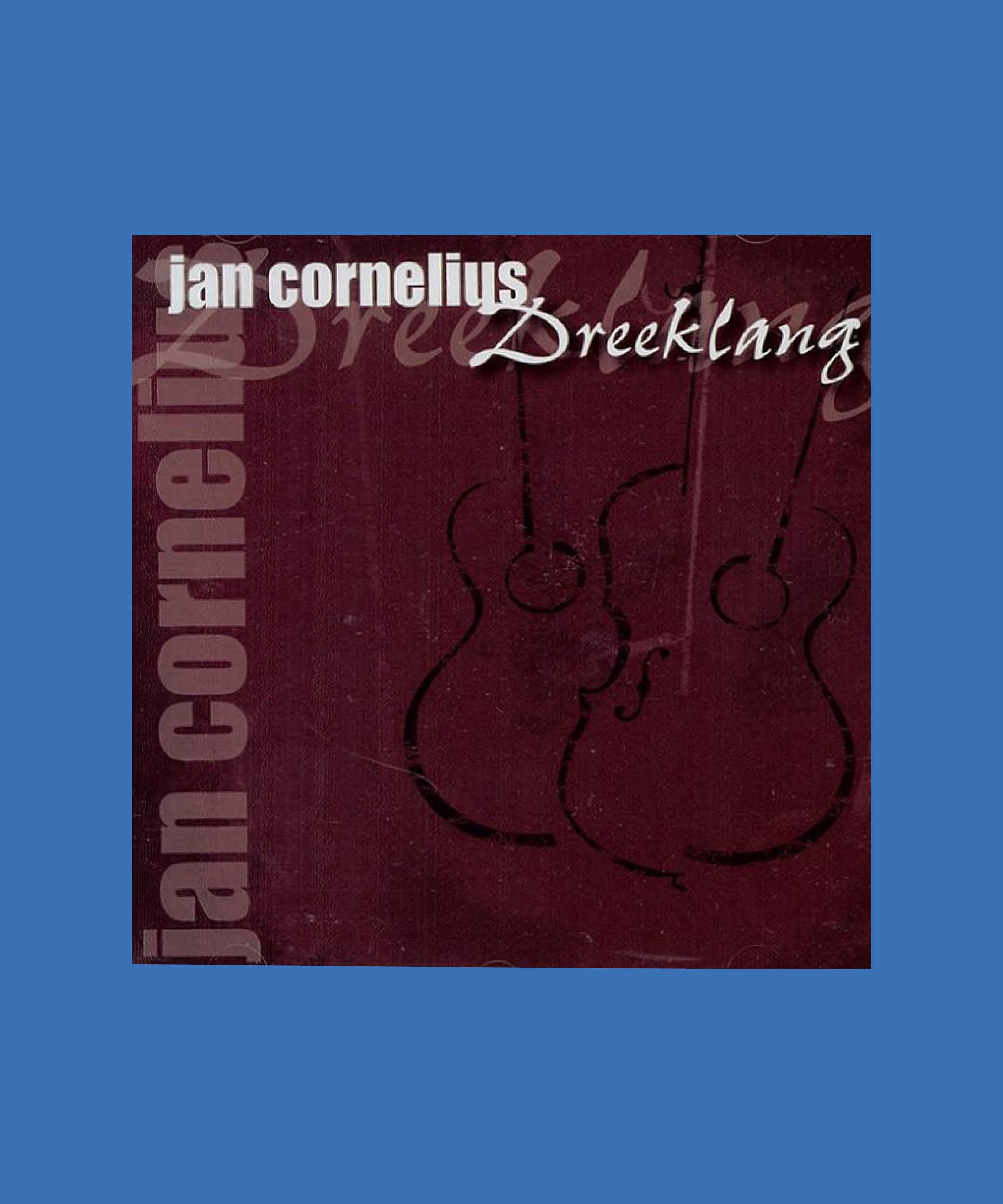
Dreeklang
Jan Cornelius
CD
Zusammen mit Klaus Hagemann und Christa Ehrig eingespielt. 14 Lieder in ostfriesischem Platt: Koomt binnen, Lüttje Lüntjes, Levensmood.
17,- Euro / 13,- Euro für Mitglieder
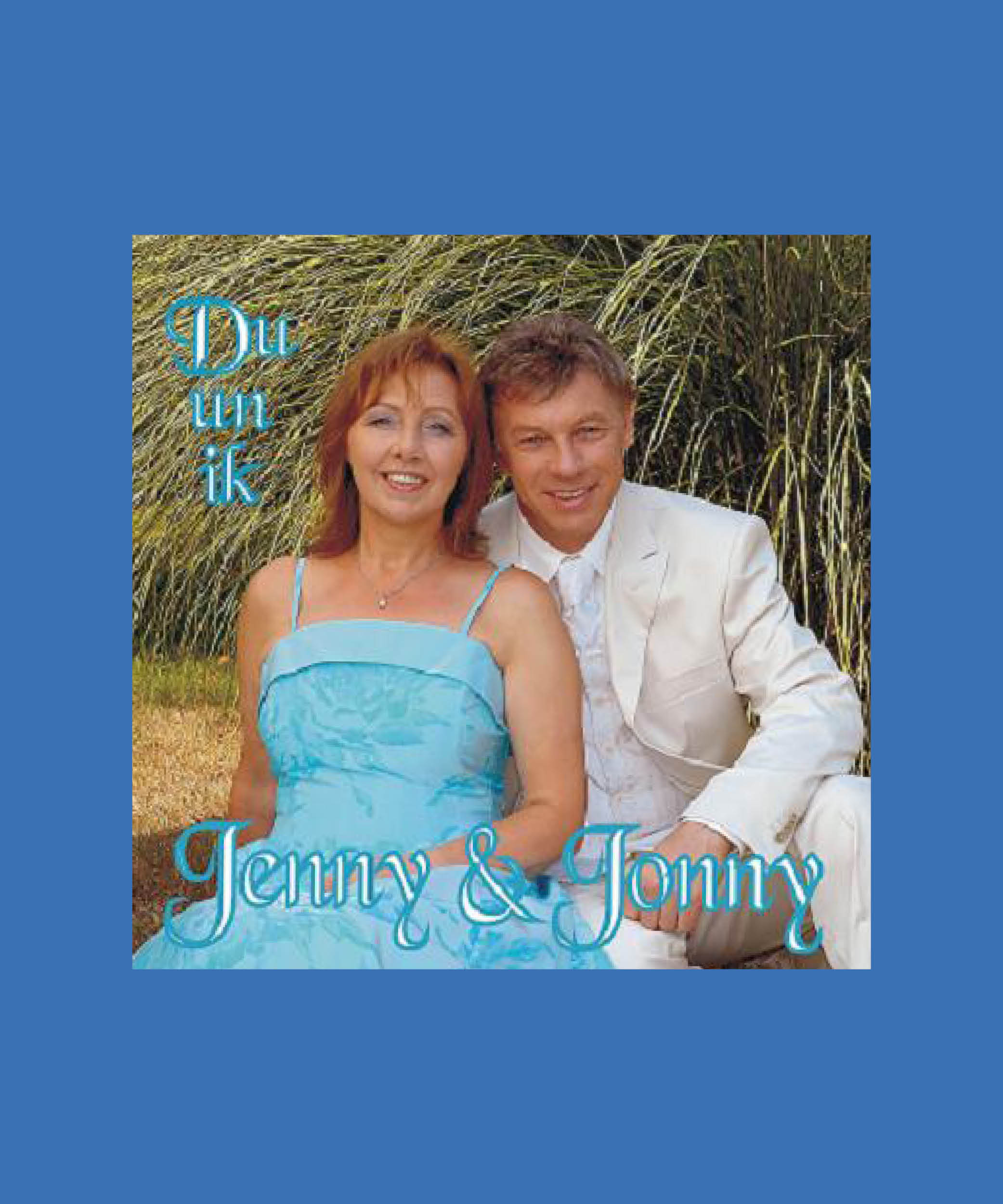
Du un Ik
Jenny & Jonny
CD
13 Lieder mit viell Gefühl gesungen in plattdeutscher Sprache von Jenny un Jonny
13,50 Euro / 10,- Euro für Mitglieder
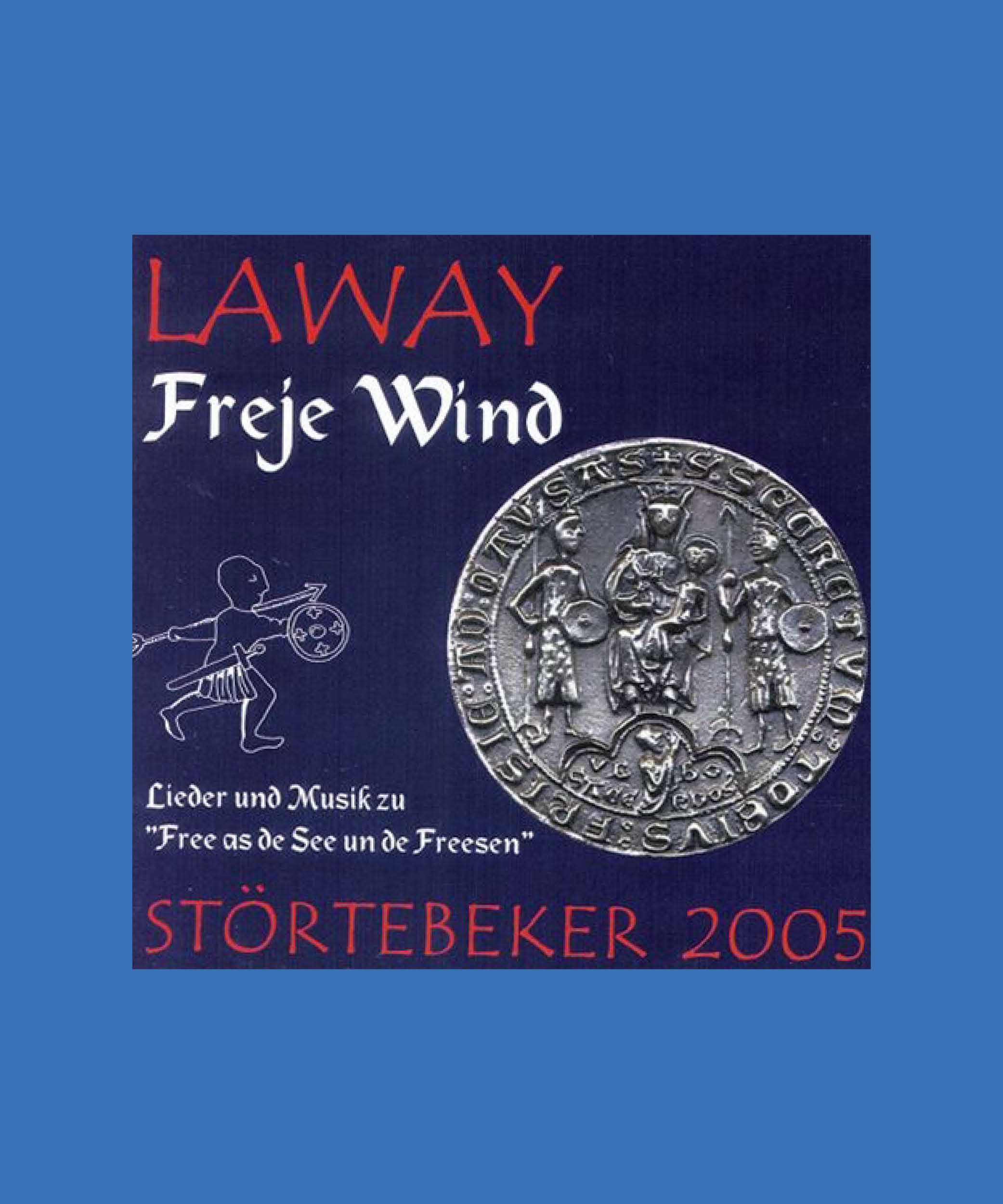
Freje Wind (IV)
LAWAY
CD
Musik zu den Störtebeker-Freilichtspielen in Marienhafe 2005.
17,- Euro / 13,- Euro für Mitglieder


